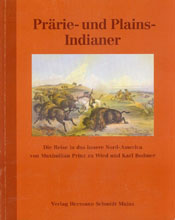3. ROT BLEIBT ROT
50er und 60er Jahre
Das Fernsehen Ende
der 40er Jahre und die nationalen europäischen Kinobewegungen Ende
der 50er Jahre begannen die Vorherrschaft der Hollywood-Studios in Frage
zu stellen. Anfang der 60er Jahre fanden die interessanten Neuerungen
an anderen Orten statt, so beim Free Cinema in England oder der Nouvelle
Vague in Frankreich. Für Hollywood waren es Jahre der Stagnation,
des Niedergangs und des Umbruchs. Weiteren Einfluß hatten der
Kalte Krieg, der bald nach Kriegsende einsetzte und mit dem Mauerbau
1961 seinen Höhepunkt erreichte, und die Hexenjagd gegen kommunistische
Unterwanderung in der McCarthy-Ära. 1950-1954 standen viele Regisseure,
Drehbuchautoren Produzenten und Schauspieler auf der schwarzen Liste,
was einem Berufsverbot in Hollywood gleichkam.
Trotzdem oder gerade deshalb wurden die Nachkriegsjahre zur Blütezeit
des Western.
John Wayne, Randolph Scott, James Stewart, Glenn Ford, Richard Widmark,
Kirk Douglas, Burt Lancaster, Henry Fonda, Gregory Peck oder Gary Cooper,
alle die großen Heroen des Westerns kamen in dieser Zeit zu Weltruhm.
Der Western brachte seine großen Klassiker hervor. Er wird veredelt
(vgl. HIGH NOON (Zwölf Uhr mittags, 1952) von Fred Zinnemann) und
endgültig zur Kunstform erhoben. Aber die ersten Parodien, die
entstehen (z.B. CAT BALLOU (1965)), zeigen bereits an, daß das
Genre seinen Höhepunkt überschritten hat und der Niedergang
beginnt.
Die Epoche ist beispielshaft
mit dem Namen John Ford verbunden, an dessen Werk sich die Metamorphose
des Indianerbildes exemplarisch nachzeichnen läßt.
Ford drehte Indianergeschichten in der frühen Stummfilmzeit, verherrlichte
die Frontier und den Pioniergeist (IRON HORSE), etabliert mit seinen
Kavalleriewestern den klassischen männlichen Heroen homerischer
Größe, demontierte ihn in THE SEARCHERS (Der schwarze Falke,
1956) und versuchte mit CHEYENNE AUTUMN (Cheyenne, 1964) eine Art Wiedergutmachung
an den im Western zu Massen vergossenen Indianerblutes.
Zuerst einmal verändert sich das Bild der Indianer in dieser klassischen
Periode nur unwesentlich. Weiterhin verlassen sie als rachedürstige
Teufel ihre Reservationen (THE HALF-BREED (An der Spitze der Apachen,
1952), überfallen als mörderisches Gesindel Wagentrecks und
unschuldige Siedler (THE CARIBOO TRAIL (Todesschlucht von Arizona, 1950),
ARROWS IN THE DUST (Pfeile in der Dämmerung, 1954)),
entführen weiße Frauen und Kinder (COMANCHE (Um jeden Preis,
1956)), und werden dafür von weißen Helden ungerührt
wie in der Schießbude abgeknallt (DISTANT DRUMS (Die Teufelsbrigade,
1951)). Und im letzten Moment reitet die rettende US-Kavallerie ein.
Doch langsam beginnen
sich in Nuancen Verschiebungen abzuzeichnen. Das Verhältnis zwischen
Indianern und Soldaten in Fords Kavalleriewestern sind hierfür
ein schönes Beispiel.
Am Anfang ist die Kavallerie die Rettung in letzter Minute (vgl. STAGECOACH,
1939) - ein traditionelles Motiv, das bald nur noch in Komik und Parodie
einen Effekt erzielt. Am Ende haben sich die Verhältnisse umgedreht:
in CHEYENNE AUTUMN (1964) sind die Indianer die Protagonisten und die
Soldaten die Feinde. Dazwischen liegen die Western der sogenannten Kavallerie
-Trilogie FORT APACHE (Bis zum letzten Mann, 1948), SHE WORE A YELLOW
RIBBON (Der Teufelshauptmann, 1949) und RIO GRANDE (Rio Grande, 1950)),
die exemplarisch für das Bild der Indianer in dieser Epoche gelten
können.
In FORT APACHE geben
die Apachen von Häuptling Cochise nur den Hintergrund ab, vor dem
John Ford das soldatische Leben und in der Parallele zu General Custer
die Demontage einer Legende entwickelt. Das Thema des neuen Befehlshabers,
der arrogant, verbittert und karrieresüchtig seine Truppe in eine
aussichtslose Situation manövriert, würde auch in jeden beliebigen
Kriegsfilm passen. Ungewöhnlich jedoch ist, daß ein indianischer
Führer einem Offizier in militärischer Taktik überlegen
erscheint und die Indianer zum Schluß den richtigen Mann zum Nachfolger
des Regiments krönen.
Die Niederlage von
General Custer am Little Bighorn River (25.06.1876) verbreitet zu Anfang
von SHE WORE A YELLOW RIBBON eine wahre Hysterie im Südwesten.
Die Kavallerie wird als kleine Schar tapferer Männer geschildert,
die gegen eine Übermacht von 10.000 Indianern die Stellung hält.
Tatsächlich beginnen die Indianer zu rauben, morden und plündern.
Ein skrupelloser Krämer versorgt sie zudem mit Winchestergewehren
und der große Aufstand scheint bevorzustehen. Da löst Captain
Brittles die Situation ohne Blutvergießen mit einem simplen Indianertrick:
er treibt den vereinigten Indianerstämmen ihre Ponyherde davon.
Neben der gezeigten Grausamkeit der Indianer kommt die ihnen zugeschriebene
zweite Eigenschaft zum Tragen: ihre Dummheit. Weil sie zu stolz sind,
um zu Fuß zu gehen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als
ihren Ponys ins Reservat zu folgen und Captain Brittles wird als Retter
des Westens gefeiert.
In der Geschichte
von der Eroberung des nordamerikanischen Kontinents werden zwei Eigenschaften
zu Nationaltugenden erhoben: Pioniergeist und Individualismus. Letzterem
erweisen die Kavalleriewestern Fords ihre Referenz.
In FORT APACHE sah Captain York nur unbeteiligt zu, wie Lieutenant Colonol
Thursday à la Custer seine Soldaten zur Schlachtbank führt,
in SHE WORE A YELLOW RIBBON handelt Captain Brittles bereits eigenmächtig,
allerdings innerhalb seiner ablaufenden Dienstzeit. In RIO GRANDE hingegen
verfolgt Lieutnant Colonel Kirby die Apachen außerhalb des Staatsgebietes
auf mexikanischen Boden und riskiert dafür ein Verfahren vor dem
Kriegsgerichts.
Individualismus
bleibt somit eine Eigenschaft des weißen Mannes, während
die Indianer weiterhin als amorphe Masse, dumm und grausam auftreten.
Lediglich ihren geistigen und militärischen Führer wird Respekt
gezollt. Doch die einzigen guten Indianer sind die alten und weisen
Häuptlinge, die wie Häuptling Pony-That-Walks in SHE WORE
A YELLOW RIBBON Captain Brittles mit "Halleluja" empfangen.
Die Erfahrungen
mit Nazideutschland aber haben auch hellhörig gemacht gegenüber
jeglichen Formen von Rassismus. BROKEN ARROW (Die gebrochene Pfeil,
1950) von Delmer Daves gilt als der erste Western, der eine neue Darstellung
in dem Konflikt zwischen Weiß und Rot einschlägt, die rassistischen
Vorurteile abbaut und damit einen Umschwung im Indianerbild des Western
einleitet.
Die nachfolgenden Indianerwestern wie APACHE (Massai, der große
Apache, 1954), THE WHITE FEATHER (Die weiße Feder, 1955) oder
THE LAST WAGON (Der letzte Wagen, 1956) und CHEYENNE AUTUMN (Cheyenne,
1964) werden in dieser Tradition gesehen.
Bereits mit der
Eingangssequenz wird das Grundthema entwickelt. Der ehemalige Soldat
Tom Jefford (James Stewart) findet einen verwundeten Apachenjungen und
statt ihm, den er für "weit gefährlicher [hält]
als eine Schlange", den Skalp abzuziehen, pflegt er ihn gesund.
Über das Kindlichkeits-Schema oder auch aus bloßem Mitleid
wird der andere Zugang zu den Indianern eröffnet. "Die Apachen
sind wilde Tiere, hatte man mir gesagt." Bei seinem ersten Zusammentreffen
mit einem Angehörigen dieses verhaßten Volkes kann er dagegen
aus eigener Anschauung feststellen, daß der Junge auch nur ein
Mensch ist wie er selber. Über die Identität - nach dem Muster:
auch ein Apachenjunge muß pünktlich daheim sein, sonst sorgen
sich Vater und Mutter um ihn - wird der Wille und Vorsatz zum Verstehen
des Anderen und seiner Kultur eingeleitet. Das geht über die bisher
in den Filmen gezeigten Affekte wie Mitleid und Sympathie für ein
verschwindendes Volk und seine bunte Folklore weit hinaus. Es ist auch
mehr als der in Fords Kavalleriewestern gezeigte Respekt gegenüber
den großen indianischen Kriegsführern. Zum ersten Mal macht
sich ein weißer Held den Ansatz von Anthropologen zu eigen, um
Zugang zu den Apachen und ihrem Häuptling Cochise zu erlangen.
Tom Jeffords nimmt Unterricht bei einem "zivilisierten" Apachen,
um Sprache, Gebräuche und Riten der Indianer zu lernen. Mit diesem
Wissen erwirbt er nicht nur den Respekt von Cochise, er kann ihn zudem
von seinen lauteren Absichten überzeugen und zu einem Friedensvertrag
überreden.
Mit BROKEN ARROW erhalten die Indianer zum ersten Mal ein eigenständiges
kulturelles Leben. Trotzdem bleibt die Darstellung noch Mittel zum Zweck:
das bessere Wissen um die Lebensumstände ermöglicht eine friedlichere
Assimilation und Eingliederung in die weiße Zivilisation. Und
nicht nur die sentimentale Zeichnung der Liebesbeziehung zwischen dem
Postreiter Jeffords und dem Apachenmädchen ist Ausdruck für
eine neue, romantisierende Stereotypisierung. In der Begegnung mit dem
großen Führer Cochise entsteht das neue Bild vom "Guten
Indianer": Die Indianer honorieren wahre Mannestugenden wie Mut,
Furchtlosigkeit und Stolz. Sie verachten Feigheit, Hinterhältigkeit
und Schmeicheleien. Sie lieben die Wahrheit über alles und halten
ihr Wort, so oft sie es geben. Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn
und handeln dementsprechend mit alttestamentarischen Strafen. Und die
Führer wie Cochise haben ihre Krieger unter Kontrolle, während
auf Seite der Weißen Friedensabsichten und Vertragszusagen vom
Mob, Banditen oder skrupellosen Geschäftsleuten hintergangen werden.
Hinter diesem Bild vom Guten Indianern mit all seinen positiven und
alttestamentarischen Tugenden verbirgt sich die Sehnsucht nach einer
vermeintlich besseren alten Zeit, in der hierarchische Strukturen und
ein verbindlicher Moral- und Sittenkodex für Recht und Ordnung
sorgten. Die Utopie vom Guten Indianer wird dem Sittenverfall und dem
vermeintlichen Untergang des Abendlandes gegenübergestellt.